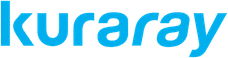Der Berliner Apotheker Eduard Simon erwarb um 1835 Styrax, das Harz des Orientalischen Amberbaumes (Liquidambar orientalis), der in Vorderasien wächst. Dieses Baumharz wurde schon bei den alten Ägyptern Parfüms und Heilmitteln beigemengt. Bei der Destillation dieses Baumwachses entdeckte er eine farblose Flüssigkeit und benannte sie nach dem Ausgangsstoff Styrol. Als er die Flüssigkeit erwärmte, bildete sich ein neuer Stoff. Er nahm an, dass es sich um Styroloxid handelte.
Der englische Chemiker John Buddle Blyth und der deutsche Chemiker August Wilhelm von Hofmann fanden jedoch 1845 durch Elementaranalyse heraus, dass sich die Stoffzusammensetzung nicht verändert hatte. Marcelin Berthelot deutete die Veränderung bei der Erwärmung 1866 völlig richtig als Polymerisation. Hermann Staudinger, der sich hauptsächlich mit der Polymerchemie befasste, beschrieb schließlich in Thesen, dass durch die Erwärmung eine Kettenreaktion gestartet wird, bei der die Makromoleküle des Polystyrols entstehen.
Ungefähr um 1930 begann die Entwicklung von technischen Verfahren zur Styrolherstellung. Vorher musste es aus dem Pyrolysebenzin isoliert werden. Während des Zweiten Weltkrieges stieg der Bedarf, weil es für das Styrol-Butadien-Copolymer benötigt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es in größeren Mengen synthetisch hergestellt, weil es eine hohe Nachfrage nach Polystyrol gab.